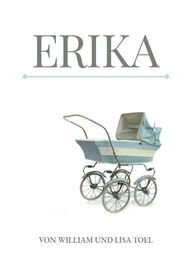
Return to flip book view
ERIKAVON WILLIAM UND LISA TOEL
– 1 –EinleitungIhr Name war Erika. Es hätte auch jeder andere der im Jahr 1922 beliebten Vornamen sein kön-nen, wie Maria, Ursula oder Ilse, doch so hieß sie nicht, denn ihre Eltern hatten sie Erika genannt – zu Ehren ihres Onkels Erik, der im Ersten Welt-krieg in Frankreich gefallen war.Erika war eine außergewöhnliche junge Frau mit etwa dreiundzwanzig Jahren an Lebenserfah-rung. Jedes einzelne dieser Jahre war erfüllt von Tagen, die mit einem „Guten Morgen“ begannen und mit einem „Gute Nacht“ endeten und Schicht um Schicht an Erinnerungen anhäuften, wovon manche traurig, aber viele schön waren, und Erika so zu der gefestigten jungen Frau heranreifen lie-ßen, die sie heute war. Doch heute spielt ihr Name keine Rolle mehr. Heute ist sie nur eine namenlose Frau, die ihre zwei kleinen Kinder in einem Kinderwagen vor
– 2 –sich herschiebt. Sie schiebt ihn die Fahrbahn ent-lang. Vor ihr unzählige andere namenlose Frauen, Kinder, Kinderwagen und alte Männer und unzäh-lige weitere hinter ihr. Mit schweren Schritten ge-hen sie durch den kalten Winter. Eisregen sticht ihnen ins Gesicht, Schneematsch dringt in ihre Schuhe. Ein unermesslich großer Zug des Elends, sich unaufhaltsam vorwärts schleppend, immer weiter, der Sicherheit entgegen. Nach Dresden, dem Florenz an der Elbe.
– 3 –Kapitel 1Mami, Mami, ich hab’ Hunger.“ Hannes, jetzt fast drei Jahre alt, blickte zu mir aus dem Kinderwagen herauf, in den er seitlich hineinge-zwängt worden war, damit sein kleines schlafen-des Schwesterchen auch noch Platz darin hatte. Glücklicherweise schlief sie seit einer guten Stunde.„Ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Wir sind bald da, und dann gibt es eine heiße Mahlzeit mit Kar-toffeln und Fleisch. Das wird uns schmecken!“„Mami, ich habe aber jetzt Hunger.“ Seine Augen verrieten mir, dass er sich nicht vertrösten ließ. Diese verschmitzten Augen, aus denen der Schalk blitzte, sie waren weich und braun und könnten je-des Mädchenherz zum Schmelzen bringen. Auf die gleiche Weise, wie einst sein Vater Johan mein Herz erobert hatte.Ich griff in die Tasche meines Mantels und zog ein Stück Brot heraus. „Liebling, das ist alles, was „
– 4 –ich habe. Iss es langsam und hebe ein wenig von dem weicheren Teil für Käthe auf, falls sie aufwacht. Wir sind bald da.“ Was ich ihm sagte, entsprach nicht der Wahrheit. Ich hatte noch drei weitere Stücke Brot und ein Stück Käse in der Tasche, aber ich wusste ja nicht, ob wir tatsächlich bald „da“ sein würden, und ich besaß keine Gewissheit darü-ber, bei unserer Ankunft eine warme Mahlzeit zu erhalten – ich hatte lediglich die Hoffnung darauf.Hoffnung. Sie muss das Einzige gewesen sein, was mich die letzten drei Tage zum Weiterlaufen angespornt hatte. Drei Tage, in denen ich den schweren Kinderwagen geschoben hatte, bis mei-ne Arme so schmerzten, dass ich dachte, sie wür-den jeden Augenblick abfallen. Wären seine Räder quadratisch, könnte es kaum anstrengender sein. Die beiden Kinder nahmen den ganzen Platz im Kinderwagen ein, und ich hatte unseren kleinen Koffer, mit den einigen wenigen Dingen, die ich hi-neinpacken konnte, auf ihm festgeschnallt. Das
– 5 –Foto von Johan war darin, welches ich tagsüber neben unserem Bett aufgestellt und nachts unter meinem Kissen aufbewahrt hatte. Außerdem je-weils drei Kleidungsstücke zum Wechseln für die Kinder, darunter der Pullover, den ich Hannes zu Weihnachten gestrickt und eingepackt hatte, ob-wohl ich wusste, dass er bald aus ihm herauswach-sen würde. Mutters Fotoalbum war auch im Koffer, gleichwohl es zu viel Platz wegnahm, ebenso ihre silberne Kaffeekanne, ihr Geschenk zu unserer Hochzeit. Ansonsten hatte ich einen Kochtopf, ei-nen Becher und zwei Löffel bei mir, dazu die golde-nen Ohrringe, die Johan mir letztes Jahr geschenkt hatte, als er über unseren Jahrestag zum Frontur-laub nach Hause gekommen war – damals hatte er Käthe das erste Mal gesehen. Die Ohrringe wa- ren noch immer in ein winziges Stück grünen Pa-piers eingewickelt und steckten in dem kleinen orangefarbenen Kordelsäckchen mit der Namens-prägung des Juweliergeschäfts, ganz so, wie er sie
– 6 –mir an jenem Tag überreicht hatte, als wir noch glücklich waren. Bevor die Sauregurkenzeit ange-brochen war.Die einzigen weiteren Gegenstände waren zwei Sockenpaare, mein zweitliebstes Paar Schuhe (es war eine schmerzliche Entscheidung, meine Lieb-lingsschuhe zurückzulassen, aber diese hier waren um Einiges praktischer), zwei Handtücher, meine kleine Stofftasche mit meiner Haarbürste und mei-nen Toilettenartikeln darin, und schließlich Groß-mutters Tischtuch mit dem blauen gestickten Rand, welches sie mir kurz vor ihrem Tod vermacht hatte. Es lag im Koffer obenauf, weil ich es bereits mehrmals täglich herausgenommen hatte, um Kä-the an meine Brust zu binden, damit Hannes im Kinderwagen Platz zum Hinlegen und Schlafen hatte.Außer den Socken und den Schuhen, die mir als Ersatz dienten, befand sich keine Kleidung von mir im Koffer. Ich trug alles in umständlicher Weise an
– 7 –meinem Körper, weil sonst kein Platz dafür gewe-sen wäre. Zwei Garnituren an Unterwäsche, zwei Kleider – das eine mit langen Ärmeln und angenäh-tem Gürtel, das andere, Johans Lieblingskleid, aus einem cremefarbenen, hauchdünnen Stoff mit kur-zen Ärmeln und einer Leiste aus Zinnknöpfen auf der Vorderseite. Er nannte mich immer seinen „kleinen Engel“, wenn ich es anhatte. Darüber hatte ich meinen wärmsten Pullover gezogen, obwohl mir dessen Farbe nie richtig gefallen hatte, sowie meinen Mantel, meinen Schal, meine Handschuhe, meine langen Socken und meine Winterstiefel. Ich trug außerdem Vaters alten Lederhut auf dem Kopf, den ich mir zum Glück in letzter Minute noch geschnappt hatte, denn er war mein einziger Schutz vor dem Eisregen. Den Regenschirm hatte ich an der Seite des Kinderwagens befestigt, in der verzweifelten Hoffnung, er möge den Kindern als Schutzschild dienen. Die Kinder hatte ich in warme Decken eingepackt.
– 8 –Kapitel 2In den letzten beiden Tagen war ich so weit ge-laufen, wie meine Füße mich getragen hatten. In der ersten Nacht hatten wir Glück, als wir an einer Feuerwache Halt machten, wo sie uns Suppe aus-gaben und ein Feldbett zur Verfügung stellten, wel-ches wir uns zu dritt teilten. Das Feldbett war alles andere als bequem und mein Rücken tat weh, trotzdem schliefen wir alle drei, aus purer Er-schöpfung.In der letzten Nacht hatten wir weniger Glück. Wir waren seit Verlassen der Feuerwache fünf Stunden gelaufen und es wurde bereits dunkel.Mit Einbruch der Dämmerung lösten sich die Menschen auf der Suche nach einer Bleibe allmäh-lich von der Kolonne. So fasste jede kleine Gruppe ihren eigenen Entschluss, ob ein gewisses Dorf oder ein bestimmter Bauernhof für die nächtliche Marschpause in Frage kommen könnte. Ich hatte
– 9 –bis jetzt noch nichts entdeckt, was für mich nach einer geeigneten Möglichkeit aussah, und gehört, dass die Leute von einer großen Notunterkunft des Roten Kreuzes in der nächstgelegenen Stadt sprachen, die noch vier Kilometer entfernt war. Wenn man eine öffentliche Unterkunft wie diese fand, konnte man nahezu sicher sein, nicht abge-wiesen zu werden. Bei privaten Bauernhöfen und Wohnhäusern war die Lage manchmal eine ganz andere. Auch wenn die Menschenkolonne von Mi-nute zu Minute schrumpfte, waren die meisten ent-schlossen, noch ein bis zwei Stunden weiterzumar-schieren.Ich hatte schon befürchtet, dass wir nicht recht-zeitig vor Einbruch der Dunkelheit von der Haupt-straße herunterkommen würden, um in die Au-ßenbezirke der Stadt zu gelangen. Nicht, dass ich Anlass zur Furcht vor den Menschen um mich her-um gehabt hätte. Jeder von uns war ein bemit-leidenswertes Geschöpf, das sich an den Akt des
– 10 –Lebens klammerte, in dem Versuch, den eigenen unfassbaren Verlust aus der Erinnerung zu ver-drängen. Nein, ich hatte Angst davor, überfahren zu werden.Nachts gehörten die Straßen den Militäreinhei-ten, die den Befehl irgendeines Kommandanten befolgten, der seine Männer von Punkt zu Punkt über die Landkarte bewegte. Ströme von Lastwa-gen beladen mit erschöpften Männern, Kübelwa-gen mit jungen entschlossenen Offizieren sowie offene Laster mit Versorgungsgütern und Kriegs-gerät rumpelten jede Nacht zum Schutz vor Entde-ckung mit abgedunkelten Scheinwerfern die Stra-ßen entlang. Auch Panzer rasselten und quietschten langsam vor sich hin. Obwohl wir sie schon aus weiter Entfernung herannahen hörten, war es schwierig, rechtzeitig einen Platz zu finden, um von der Straße herunterzukommen. Bei dieser Witterung, den tückischen Straßenverhältnissen und der eingeschränkten Sicht des Fahrers war die
– 11 –Gefahr, überfahren zu werden, sehr hoch. Ganz zu schweigen von der anfänglichen Panik wegen der Unsicherheit darüber, ob es welche von unseren sein würden.Hannes’ Kopf wippte nun schon eine ganze Wei-le hin und her. Der arme kleine Mann konnte nicht einmal sein süßes Köpfchen ablegen, doch er war zu erschöpft, um zu weinen. Ich hatte bereits meh-rere Male angehalten, um nachzusehen, ob Käthe noch atmete – sie war sehr still.O Gott, bitte beschütze meine lieben Kinder! Die Last, für sie der alleinige Schutz vor dem Tod oder einem schrecklichen Unfall zu sein, ist zu viel für mich. Ich kann das nicht! Ich bin ebenso hilflos, wie sie es sind.Aber ich muss. Ich muss. Ich muss sie beschüt-zen. O Gott, bitte hilf mir.Der Eisregen wurde erbarmungsloser, der Wind frischte auf. Was nützte es, die Notunterkunft des Roten Kreuzes zu erreichen, wenn die Kinder auf
– 12 –dem Weg dorthin dem Erfrieren ausgesetzt waren? Ich wusste, dass dies eine ernstzunehmende Be-drohung darstellte. Vor ein paar Stunden waren wir an zwei Frauen vorbeigekommen, die sich wei-nend in den Armen lagen. Beide hatten in der Nacht zuvor ein Kind verloren.Ich erblickte mehrere zusammenstehende land-wirtschaftliche Gebäude unweit der Straße. Sie waren nah genug, so dass ich nicht zu viel kost- bare Zeit für den Hin- und Rückweg verlieren würde, sollte ich abgewiesen werden. Ein paar andere hatten dieselbe Idee, und so folgte ich ihnen, als sie von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbogen. Etwa fünfzehn von uns, die Kinder nicht mitgezählt, hofften darauf, sich der Gnade eines Fremden anvertrauen zu können. Die Bauersfrau empfing uns am Tor. Natürlich war kein Bauer anwesend – gar keine Männer. Das Haus war bereits belegt, doch wir konnten auf dem
– 13 –Heuboden übernachten. Sie hatte nichts zu essen für uns, stellte uns aber ein Ei für den nächsten Morgen in Aussicht.Eine Übernachtung auf dem Heuboden. Davon hatte ich als kleines Mädchen immer geträumt. Im Traum hatte ich romantische Vorstellungen von zufriedenen Kühen und Pferden in den Stallungen unter mir, die mich verstehen konnten, wenn ich mit ihnen sprach, und die mir zusicherten, die gan-ze Nacht hindurch meine treuesten Wächter zu sein.Doch die Pferde waren längst fort. Sie waren zu-sammen mit dem Bauern abberufen worden, ihren Beitrag zu leisten. Zwei Kühe waren noch da – so gab es möglicherweise Milch für die Kinder am Morgen. In unserer kleinen Gruppe aus einander unbe-kannten Menschen halfen wir uns gegenseitig, die Leiter in der Scheune hinaufzusteigen, indem die Kinder von Hand zu Hand weitergereicht und die
– 14 –schwächeren Erwachsenen nach oben geschoben oder gezogen wurden. Ein älterer Mann kam als Letzter hinauf, wo er von einigen Frauen stützend in Empfang genommen wurde. Schwerfällig ließ er sich neben Hannes ins Heu sinken. Ich glaube, er war zu erschöpft zum Sprechen, dennoch versuch-te er, höflich zu sein.„Er ist ein feiner junger Bursche.“„Danke.“„Ich hatte auch mal einen Sohn. Er …“ Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern drehte sich auf die Seite, und gleich darauf konnte ich an den Bewe-gungen seiner Jacke erkennen, dass er eingeschla-fen sein musste. Ja, und ich hatte auch einmal einen Vater. Er dürfte ungefähr in Ihrem Alter gewesen sein. Viel-leicht habt Ihr Euch gekannt, als Ihr noch jün- ger wart. Vielleicht seid Ihr während der dunklen Zeiten zusammen in der Kneipe gesessen, als es keine Arbeit gab und die Männer, die den Ersten
– 15 –Weltkrieg überlebt hatten, bei ihrer Rückkehr nach Hause geschlossene Fabriken und ein völliges Chaos auf den Straßen vorfanden.Meine Mutter und mein Vater hatten sich vor dem Krieg einander das Jawort gegeben, und schon kurz danach wurden meine beiden älteren Brüder geboren. Als ich auf die Welt kam, hatte Papa im-mer noch keine sichere Anstellung und lief stets Gefahr, am Fabriktor mit den Worten „Heute gibt es keine Arbeit für dich“ abgewiesen zu werden. Mut-ter musste immer einen kleinen Betrag vom Haus-haltsgeld zurückbehalten, für den Fall, dass es uns in der folgenden Woche noch schlechter ergehen sollte.Ich erinnere mich an meine frühen Jahre nur noch im Schein verblasster Farben. Nicht allein we-gen des zeitlichen Abstands, sondern auch, weil bei uns alles abgenutzt, oft schmutzig und ver blichen war. Unsere Wohnung hatte seit Jahrzehnten kei-nen neuen Anstrich erhalten und die Betontreppe,
– 16 –auf der ich an sonnigen Tagen immer gesessen bin, bröckelte im Zustand traurigen Verfalls vor sich hin. Wir besaßen zu jener Zeit nur selten etwas Neues, sogar die Gesichter meiner Eltern schienen frühzeitig verbraucht und sorgenzerfurcht. Erst später konnte ich ermessen, wie schwer sie es da-mals hatten. Ein kleines Kind betrachtet seinen Papa als großen, starken Helden, und es hat noch nicht die leiseste Ahnung davon, wie der Stolz ei-nes Mannes durch unaufhörliches Elend, ständige Entbehrungen und nicht enden wollende Pech-strähnen gebrochen werden kann. Er hat mehr ge-trunken, als gut für ihn war. Und er hat sich selbst dafür gehasst. Das kann ich heute nachvollziehen. Ich verstehe jetzt, dass meine Eltern natürlich Er-leichterung und Freude empfanden, als die fetten Jahre endlich kamen, und doch schwelte unter der Oberfläche fortwährend das Gefühl, einen Verlust erlitten zu haben. Das Gefühl, dass diese Zeit für sie beinahe zu spät kam, wo doch das Alter, in dem
– 17 –sie ihre besten Jahre hätten erleben sollen, bereits hinter ihnen lag.Die Kinder schliefen nun beide auf dem süßlich duftenden Heu. Ich legte meinen Arm um sie und zog den Rand der Decke über meine Beine. Ich fragte mich, ob sie wohl noch zu jung waren, um diese Nacht auf dem Heuboden über den Kühen in Erinnerung zu behalten.
– 18 –Kapitel 3Heute Morgen wurde ich von den Kühen ge-weckt, die in ihrem Stall allmählich unruhig wurden. Ein paar Minuten lang lag ich nur da, um dem Gezwitscher der Vögel zu lauschen, die gerade ihren Tagesbeginn einläuteten. Einige der anderen Erwachsenen fingen an, sich zu regen, bloß der äl-tere Mann lag noch immer auf der Seite, in der glei-chen Position, in der er sich schlafen gelegt hatte. Ich wollte es ihm nicht verdenken. Keiner von uns war erpicht darauf, sich wieder auf den Weg zu ma-chen.Käthe begann zu wimmern, und so nahm ich sie hoch, um sie zu stillen. Ihre kleinen Hände gru-ben sich zart in meine Haut. Sie wirkte so viel kleiner als Hannes in ihrem Alter. Ich war selbst dermaßen unterernährt, dass ich sie sicherlich nicht ausreichend versorgen konnte. Wie schlimm musste es erst den Witwen und Waisen in dieser
– 19 –Zeit der knurrenden Mägen ergehen. Es gab kaum einen Menschen, dessen Kleider nicht schlaff an ihm herunterhingen.Hannes war mittlerweile auch aufgewacht, also schnürte ich ihm die Schuhe und raffte die Decke zusammen, damit wir nach unten steigen konn- ten, um einen geeigneten Platz zu finden, an dem wir unsere Notdurft verrichten konnten. Die an-deren bewegten sich ebenfalls in diese Richtung, bloß der alte Mann hatte sich noch immer nicht gerührt.„Hallo, guten Morgen!“ Ich streckte meine Hand nach unten, um vorsichtig an seiner Schulter zu rütteln, aber er war tot.Zwei weitere Frauen kamen herüber, um nach ihm zu sehen. Woher war er gekommen? Das wuss-te niemand. Sein ausgezehrter Körper – umringt von Fremden. Ob ihn jemand vermissen würde? Oder würde es allezeit so sein, als hätte es ihn nie gegeben? Er war doch jemandes Sohn, Bruder,
– 20 –Onkel, Vater oder vielleicht Großvater. Ob es wohl einen Menschen gäbe, der sich an ihn erinnern würde?Wir kletterten die Leiter hinab, und nachdem wir uns abwechselnd Hände und Gesicht in einem Eimer gewaschen hatten, beratschlagten einige von uns, was zu tun sei.„Wir müssen ihn dort zurücklassen. Wir können ihn nicht nach unten schaffen“, sagte einer.„Aber wir sollten der Bauersfrau Bescheid sa-gen …“„Willst du etwa den ganzen Tag hier verbrin-gen?“Damit war die Diskussion beendet. Ich für mei-nen Teil fühlte mich peinlich berührt, die warmen hartgekochten Eier anzunehmen, die mir die Bau-ersfrau in die Hand drückte, wohl wissend, was sie im Laufe des Tages vorfinden würde. Es schien das Los der Frauen zu sein, sich mit diesem heillosen Durcheinander herumschlagen zu müssen, wel-
– 21 –ches die Männerwelt erschaffen hat. Die Trauer ist unser ständiger Begleiter, und doch müssen wir immer weitermachen – irgendwie.Als wir auf die Straße zurückkehrten, war der Flüchtlingsstrom bereits in Bewegung. Mit ande-ren Menschen als gestern, doch waren sie alle in derselben erbärmlichen Lage. Alte Männer, die Handkarren hinter sich herzogen. Kinder mit dünnen Beinchen, ihren Kleidern längst entwach-sen, die ihre Schulranzen mit sich trugen, gefüllt mit den einzigen noch verbliebenen Habselig-keiten. Außerdem unzählige Frauen. Große dünne Frauen mit in Kopftüchern hochgebundenen Haa-ren, Frauen in Hosen, alte verkrüppelte Frauen, die tapfer ihres Weges humpelten sowie junge Frauen, die einen Kinderwagen vor sich herscho-ben, wie ich. Es war noch gar nicht so lange her, dass wir es kaum abwarten konnten, die neueste Ausgabe der Zeitschrift „Das Leben“ in den Händen zu halten, um über den angesagtesten Haarschnitt
– 22 –oder die Romanze eines Filmstars im Bilde zu sein. Wer hatte uns unsere Unschuld entrissen? Wir wollten nie einen Krieg. Schier endlose Kolonnen von Frauen haben sich mühsam durch die Ge-schichte geschleppt, den Flammen abgerungen, was sie retten konnten, Kinder auf die Welt ge-bracht und um sie getrauert, ihre Männer geliebt und sie verloren. Wenn das nicht der blanke Hohn ist!Wir erreichten die Notunterkunft des Roten Kreuzes am späten Vormittag, wo wir Suppe mit einer Kartoffel, fünf Scheiben Brot und ein Stück Käse bekamen. Ich riss eines der Brotstücke in kleine Bröckchen, damit Hannes seiner Lieblings-beschäftigung nachgehen und sie in die Suppe tun-ken konnte. Käthe nahm erst seit Kurzem feste Nahrung zu sich, also fischte ich die Kartoffel aus der Suppe heraus und zerdrückte sie zwischen meinen Fingern in kleine Stücke, um sie so für sie aufzuweichen und abzukühlen.
– 23 –Die Menschen dort waren sehr freundlich. Eine Krankenschwester strich Hannes wehmütig über das Haar, als sie ihm eine Tasse Milch reichte. Die Kinder standen bereits seit langem im Mittelpunkt unseres Landes. Egal, was sich an Neuem ereigne-te, ob es sich um neue Bauvorhaben oder einen Richtungswechsel in der Politik handelte, das erste Interesse galt immer den Kindern. Es war eine Hoffnung für die Zukunft, an die wir uns alle so sehr gewöhnt hatten, als ob es schon immer so ge-wesen wäre und immer so bleiben würde. Wir glaubten daran, dass das Leben für unsere Kinder besser werden würde, wenn wir alle einander be-hilflich waren, weil wir erlebt hatten, wie es Wirk-lichkeit wurde – beinahe.
– 24 –Kapitel 4Wieder zurück auf der Straße konnten wir be-obachten, wie sich die Wolken von Westen her zu einer dicken Wand auftürmten. Unterwegs zu sein, ohne ein Zuhause, in das man jederzeit zurückkehren kann, und ohne zu wissen, wohin, müde, hungrig und elend im Gemüt, ist schon na-hezu unerträglich. Dabei auch noch durchnässt zu sein, eine grausame Qual.Wenn ich über die nächsten Stunden hinweg ein gutes Tempo beibehalten konnte, könnten wir es bis Dresden schaffen. Dort könnten wir vielleicht ein paar Tage bleiben und ich mich währenddes-sen für unser nächstes Ziel entscheiden. Aber ich war nicht in der Lage, jetzt darüber nachzudenken. Ich setzte bloß einen Fuß vor den anderen, klam-merte mich an die Kinder, hoffte auf ein wenig Freundlichkeit irgendeines Fremden und betete, dass es ein Morgen geben würde.
– 25 –Vor uns lag eine kleine Ausbuchtung am Straßen- rand, die von ein paar großen Buchen gesäumt war. Vielleicht war dies in glücklicheren Tagen ein Platz für Familien, die hier auf der Durchreise Halt mach-ten, um ihre Picknickdecke auszubreiten. Mehrere Menschen standen dort, lehnten an den Bäumen oder saßen auf der Erde. Das war nichts Ungewöhnliches, da jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit voranging. Als wir uns der Gruppe näherten, fiel mir etwas abseits von den anderen sitzend eine Frau auf, den Kopf vornübergebeugt in die Hände gestützt, als hoffte sie, dass die Welt um sie herum sich einfach in Luft auflösen würde. Ihr dunkelblondes Haar hing lose und strähnig herunter, fiel über ihre Hän-de, und war vermutlich weit vor seiner Zeit mit Grau durchzogen. Gerade als wir mit den quiet-schenden Rädern des Kinderwagens an ihr vorbei-liefen, hob sie müde den Kopf.„Lieselotte!“ Seit drei Tagen war ich keinem vertrauten Gesicht begegnet, doch in dieser gebro-
– 26 –chenen Frau erblickte ich das mir einst bekannte Mädchen.Sie sah mich verwundert an.„Ich bin’s. Erika.“„Erika?“„Ja. Wir waren zusammen beim BDM1.“Da ging ihr endlich ein Licht auf, und sogleich wechselte ihre Miene von dem in die Ferne ent-rückten abwesenden Blick zu einem die Gegenwart wahrnehmenden Ausdruck. Wir umarmten uns und weinten.„Komm mit mir nach Dresden“, sagte ich. „Wir können uns dort eine gemeinsame Bleibe suchen.“„Nein, viel weiter kann ich heute nicht mehr gehen. Ich wollte dorthin zurück“, womit sie in die Richtung zeigte, aus der ich gerade gekommen war.„Wirst du zurechtkommen?“1 Abkürzung für „Bund Deutscher Mädel“
– 27 –„Ich denke schon.“ Sie zögerte, bevor sie weiter-sprach. „Ich bin zu spät rausgekommen. Ich habe die Russen kennengelernt.“Sie brauchte mir nicht zu erklären, was sie da-mit meinte. Das stechende Gefühl in der Magen-grube sagte es mir unmissverständlich. Wir hielten uns für einen Moment an der Hand, Tränen liefen über unsere Wangen. Ich trauerte um das schöne junge Mädchen, das ich einst kannte, und um mei-ne eigene, mir ebenfalls geraubte Unschuld. Aber ich wusste, dass ich um der Kinder willen weiter-gehen musste. Wortlos küssten wir uns auf die Wange, und so setzte ich, noch immer weinend, meinen Weg fort. Vor der Wegkrümmung drehte ich mich nochmals um, vielleicht ein letztes Winken – doch sie war verschwunden.Wir lernten uns am ersten Tag unseres Beitritts in den BDM kennen. Mutter hatte mir dabei gehol-fen, meine Uniform zu nähen, bestehend aus einem
– 28 –dunkelblauen Rock und einer frischen weißen Blu-se. Zuhause hatten sich die Dinge zu dieser Zeit mittlerweile zum Besseren gewendet. Papa ging einer guten Arbeit nach und hatte Mutter eine neue Nähmaschine gekauft. In jenen Jahren schien es mir, als würde alles nicht mehr in Schwarz-Weiß, sondern wie in einem wundervollen Farbfilm ab-laufen.So wirkte es auch nur natürlich, dass unser Land zur gleichen Zeit aufblühte, wie ich es tat. Für ein junges Mädchen besteht der Daseinszweck der Welt offenbar nur in dem, was diese ihm zu bieten hat, sobald es seinen Blick über das Kinderzimmer und den Spielplatz hinaus zu erweitern beginnt.Im Sommer zuvor gingen die Mädchen und Jun-gen, die ich kannte, alle nur mit Unterhosen beklei-det im See schwimmen. Aber im darauffolgenden Sommer hatten wir uns irgendwie verändert, und wir Mädchen erröteten, wenn wir daran zurück-dachten. Wir waren wie junge Rehkitze, die in
– 29 –Schüben heranwuchsen und noch immer wackelig auf den Beinen. Wir waren verwundbar bei unse-rem Gang durch die Welt da draußen und unbe-darft im Umgang mit ihr.Endlich alt genug zu sein, um dem BDM beizu-treten, war das Aufregendste, was bis dahin je in meinem Leben passiert war, und in den Wochen davor verbrachte ich jeden Augenblick damit, mir auszumalen, wie ich an Ausflügen teilnehmen, mit den anderen BDM-Mädchen durch die Stadt flanie-ren und von den jüngeren Mädchen bewundert werden würde.Lieselotte und ich standen nebeneinander, als wir an jenem ersten Tag unser Gelöbnis vortrugen, und wir wurden auf der Stelle die dicksten Freun-de. Ihr Vater war ein Büroangestellter, der erst kurz zuvor mit seiner Familie wegen seiner neuen Anstellung umgezogen war. Aber Lieselotte störte sich nicht daran, dass mein Vater in einer Fabrik arbeitete. An solchen Dingen nahm niemand mehr
– 30 –Anstoß. Jeder hatte einen Platz auszufüllen und seinen Anteil zum Aufbau des Landes beizusteu-ern. Was auch immer man tat, wenn man hart dar-an arbeitete, wurde man respektiert. Niemand wurde ausgeschlossen, vorausgesetzt, man wollte einen Beitrag leisten, und so hatten selbst die Kin-der das Gefühl, wichtig zu sein. Wir alle hatten sol-che Hoffnung damals, ob jung oder alt. Niemals wäre es jemandem in den Sinn gekommen, dass die Zukunft anders als rosig verlaufen könnte und unsere Träume sich nicht erfüllen würden.Unsere Zeit bei den BDM-Treffen bestand nahe-zu in gleichen Teilen aus Lernarbeit, praktischen Tätigkeiten zur Umsetzung des Gelernten – und Tagträumen. Selbst wenn wir nähen oder kochen lernten oder literarische Werke lasen, träumten wir. Das häufigste Thema war die Frage, wen wir eines Tages heiraten würden und wie er wohl sein würde, wobei wir die Vorzüge und Schwächen der Jungen, die wir kannten, erörterten. Immer wenn
– 31 –wir im Sommer zelten gingen, starrten wir traum-verloren ins Lagerfeuer und hofften und beteten, Gott möge einen ganz besonderen jungen Mann auserwählt haben, der wie geschaffen für jeden von uns war. Wir sahen unserer Zukunft in ge-spannter Vorfreude und mit leuchtenden Augen entgegen. Doch dieses Leuchten war Lieselottes Augen nun abhandengekommen.
– 32 –Kapitel 5Hannes hat seine Scheibe Brot inzwischen ver-speist. Fast, denn ein kleines Stückchen hält er noch für Käthe in seinem Händchen umklam-mert, „um es warmzuhalten“. Wir befinden uns jetzt am Stadtrand von Dresden, und wir erkennen hinter den wenigen einzeln stehenden Häusern, an denen wir vorbeikommen, die beginnenden Häuserzeilen, die sich bis zum Stadtzentrum er-strecken.Ich war zuvor bereits zweimal in Dresden gewe-sen. Einmal während eines Ausflugs des BDM, bei dem wir in einer Jugendherberge übernachteten und die ganze Stadt durchstreiften, um ihre sagen-hafte Geschichte und Architektur zu erkunden. Die Semperoper war unser einhelliger Lieblingsplatz, da wir von der Eleganz des Gebäudes und der Gär-ten dahinter begeistert waren und uns vorstellten, wie sich die Hofdamen die edlen Juwelen umleg-
– 33 –ten, die wir im Grünen Gewölbe des Residenz-schlosses bestaunt hatten. Unser Reiseführer führ-te uns in die höfischen Umgangsformen ein und ließ uns sogar üben, wie man einen Hofknicks macht und nach der damals üblichen Weise tanzt. Am Abend besuchten wir eine Oper, ein erstma-liges Erlebnis dieser Art für alle von uns, mit nur einer Ausnahme, glaube ich. Es wurde „Die Zauber-flöte“ gegeben, und wir alle waren auf Anhieb bis über beide Ohren in Tamino verliebt. Von unseren Stehplätzen im hinteren Bereich des Balkons konn-ten wir das gesamte Publikum und den größten Teil der Bühne überblicken. Noch nie hatten wir so viele Menschen aus verschiedenen Ländern zu Gesicht bekommen. Während der Pause dachten wir uns ein Spiel aus, bei dem wir alle anwesenden Nationalitäten notierten, und wenn wir jemanden sahen, der kein Deutscher zu sein schien, stellten wir uns vor und fragten denjenigen höflich, aus welchem Land er kam. Es muss auf all die vornehm
– 34 –gekleideten Menschen sehr reizend gewirkt ha- ben, einer Horde schlaksiger Schulmädchen mit ihren Uniformen und geflochtenen Zöpfen zu be-gegnen, die so neugierig auf die Welt und ihr ge-genüber so aufgeschlossen waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, in dieser Nacht im Schlafsaal mit Lieselotte im Stockbett über mir überhaupt ein Auge zugemacht zu haben. Aber schließlich ver-stummte das Geschnatter, nachdem wir uns einge-hend mit dem Sinn von Taminos und Paminas Prü-fungen durch Feuer und Wasser hindurch beschäftigt sowie die Frage geklärt hatten, welche symbolische Bedeutung die Rolle des Papageno haben könnte.Das zweite Mal kam ich für einen Sommerur-laub mit meinen Eltern nach Dresden. Diese Ur-laubsfahrten waren für uns mittlerweile zur Nor-malität geworden, und die alljährliche Besprechung darüber in der Silvesternacht wurde stets von Papa mit folgender Frage eröffnet: „Also, ihr jungen
– 35 –Hühner, wo soll es dieses Jahr hingehen?“ Wir wa-ren mit Mutter und Vater in einer netten kleinen Pension untergebracht, nur ein paar Gehminuten von den entlang der Elbe gelegenen Brühlschen Terrassen entfernt. Jeden Tag machten wir einen anderen Ausflug, wir besuchten die Frauenkirche und ein Museum oder unternahmen eine Spazier-fahrt hinaus zur Moritzburg, aber den Nachmittag ließen wir immer bei einem Bummel entlang der Elbe mit einem Eis auf der Hand ausklingen. Mei- ne Eltern waren so glücklich an solchen Tagen. Mit diesem Bild werde ich sie in Erinnerung behal-ten – wie sie Arm in Arm dahinschlendern und mit der Sonne um die Wette strahlen.Ich kenne mich also ein wenig aus rings um Dresden. Und so stellt sich ein vertrautes, warmes und wohliges Gefühl ein, das mich hinzieht, wäh-rend das Unheil um mich herum mich davor zu-rückschrecken lässt, auch nur einen weiteren Schritt voranzugehen.
– 36 –Inzwischen habe ich keine allzu große Angst mehr, nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs zu sein, da die Straßen mit Bürgersteigen ausgestattet sind und es außerdem viele kleine Seitenstraßen gibt, in die man notfalls schnell ausweichen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, überfahren zu wer-den, ist ohnehin sehr gering. In Dresden ist kein Militär anzutreffen.
– 37 –Kapitel 6Endlich haben wir die erste Haltestelle der Stra-ßenbahn erreicht – oder auch die Endhalte-stelle, je nachdem, welche Richtung man ein-schlägt. Viele der Flüchtlingskolonnen haben sich bereits zerstreut, jeder versucht so gut es geht auf eigene Faust zu seinem persönlichen Marschziel zu gelangen. Meines ist die Pension, in der wir einmal vor Jahren übernachtet haben. Wenn ich dort kei-nen Erfolg haben sollte, gehe ich weiter zur Jugend-herberge auf der anderen Seite des Großen Gar-tens.Die Fahrt mit der Straßenbahn bietet eine nette Abwechslung für Hannes und eine willkommene Ruhepause für meinen Körper. Jemand hilft mir, den Kinderwagen in den Waggon zu hieven, und mit Käthe auf dem Schoß lasse ich mich auf die Bank sinken. Hannes dreht seine Runden durch den Wagen, geht von einem Ende zum anderen,
– 38 –während er rät, an welcher Haltestelle wir ausstei-gen werden. „Ist es diese hier, Mami?“Jedes Mal, wenn er hinter den Beinen und dem Gepäck der anderen Leute aus meinem Blickfeld verschwindet, werde ich ein bisschen nervös, aber er kommt immer sogleich zurück, und zu-weilen höre ich zuerst nur seine Stimme, wenn er gerade die Frage eines Fremden nach seinem Na-men oder seinem Alter beantwortet oder nach dem Verbleib seiner Mama gefragt wird: „Die ist da drüben.“Obwohl es jetzt vollkommen dunkel ist, kann ich durch das Fenster der Straßenbahn Menschen erkennen, die ihrem gewohnten Alltagsleben nach-gehen. Schulkinder fahren mit dem Fahrrad nach Hause, Frauen mit Einkaufskörben in der Hand tre-ten aus den Läden heraus, an deren Fassade zwar Jalousien zur Verdunkelung angebracht sind, die aber für den Verkauf geöffnet haben. Gelegentlich sieht man einen Mann in Uniform, wovon mancher
– 39 –vielleicht gerade auf Fronturlaub zu Hause oder unterwegs zu einem anderen Ort ist. An einer der Haltestellen steigt ein junger Mann in mühevoller Anstrengung auf Krücken zu, sein linkes Hosen-bein hängt dabei schlaff von der Hüfte herunter. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Johan. Ruckartig drehe ich meinen Kopf in die andere Richtung und blinzle die Tränen fort. Daran kann ich jetzt auf kei-nen Fall denken. Wir steigen am Altmarkt aus, wo es eine städti-sche Suppenküche gibt, die von einheimischen Freiwilligen und Mädchen des BDM betreut wird. Ich habe es geschafft, Hannes die versprochene heiße Mahlzeit zu besorgen, doch ich glaube, er ist zu hungrig, um zu bemerken, dass er kein Fleisch vorgesetzt bekommt. Ich frage nach der Pension.„Ja, die gibt es noch, in der Kreuzstraße.“Allerdings fügt sie hinzu, dass diese vermut- lich voll belegt sein wird, es sei denn, ich würde dort jemanden kennen. Die Stadt ist überfüllt mit
– 40 –Menschen, die auf der verzweifelten Suche nach einem Bett sind.Da wir uns in unmittelbarer Nähe befinden, beschließe ich, mein Glück zu versuchen. Mein trübes Gedächtnis und die dunklen Straßen las- sen mich zweifeln, ob ich auf dem richtigen Weg bin, doch bald finde ich die gesuchte Tür. Die Frau, die sich auf mein Läuten hin meldet, klingt sehr einfühlsam. Nein, sie hätten beim besten Willen kein Zimmer mehr frei, jedoch bietet sie mir an, in der Jugendherberge anzurufen, um sich zu erkundigen, ob sie uns aufnehmen würden. Nach ein paar bangen Minuten des Wartens und Betens höre ich, wie sie zur Tür kommt und diese öffnet.„Hier mein Schatz. Das ist die Adresse. Dorthin kannst du deine Kleinen bringen.“ Mit diesen Wor-ten reicht sie mir einen Zettel.Nur noch ein kleines Stückchen, ungefähr zwan-zig Minuten, und wir können uns eine Nacht aus-
– 41 –ruhen, vielleicht auch zwei. Morgen früh sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich bedanke mich und erzähle ihr von meinen liebevollen Erinnerungen an meinen früheren Auf-enthalt zusammen mit meinen Eltern, woraufhin ich den Kinderwagen wieder in Bewegung setze, um zu unserer letzten Etappe in Richtung Großer Garten aufzubrechen.Unterwegs kommen wir an mehreren Gruppen von Kindern vorbei, die für einen Faschingsball verkleidet sind. Kaum ein Erwachsener hat in den letzten beiden Jahren Karneval gefeiert, aber viele Familien versuchen dennoch, die Tradition auf-rechtzuerhalten, damit die Kinder die Möglichkeit haben, so etwas wie ein normales Leben kennen-zulernen. Die Kinder in den Gruppen lachen mitei-nander und necken sich gegenseitig; eine harmlose Art, ein bisschen Dampf abzulassen.Es ist fast acht, als wir in der Jugendherberge ankommen. Unmittelbar erkenne ich das eiserne
– 42 –Tor in der Mauer und den Löwenkopf über der Tür. Das Haus scheint nicht mehr ganz so geräumig zu sein wie damals, aber natürlich war ich zu dieser Zeit auch kleiner gewesen. Die Jugendherberge ist obdachlosen Müttern mit kleinen Kindern vorbe-halten, von denen es inzwischen Millionen geben muss. Die Herbergsmutter händigt mir eine Decke sowie ein Handtuch aus und führt mich in den lärmerfüllten Schlafsaal mit plaudernden Frauen, weinenden Babys und jüngeren Kindern, die auf dem Boden spielen. Hannes nähert sich zaghaft zwei kleinen Mädchen. Das ältere nimmt ihn bei der Hand. Ich lege mich aufs Bett, wobei ich die Füße noch auf dem Boden lasse, und schließe für einen Au-genblick die Augen. Ich bin so müde, dass ich ein-schlafen und nie mehr aufwachen könnte, aber ich raffe mich wieder auf. Jetzt noch die Kinder wa-schen und ins Bett bringen, bevor ich mich selbst zur Ruhe begebe. Als ich die Kinder zum Einschla-
– 43 –fen gebracht habe, um danach unsere wenigen Habseligkeiten zu ordnen und meine Kleider über den Kinderwagen lege, ist es bereits nach neun Uhr. Ich versuche, ins Bett zu schlüpfen, ohne Han-nes dabei zu stören. Käthe schläft im Kinderwagen, so haben wir ein bisschen mehr Platz. Es sind im-mer noch ein paar Frauen auf den Beinen, aller-dings ist es jetzt ruhiger, und ich bin gewiss, dass es nur noch einen kurzen Moment dauern wird, bis auch ich eingeschlafen bin.
– 44 –Kapitel 7Nur eine knappe Stunde später schrecke ich aus dem Schlaf hoch. Das Heulen der Luftschutz-sirenen! Verwirrt wache ich auf. Einen Moment lang weiß ich nicht, wo ich bin. Eine der Frauen im Saal ruft „Luftangriff!“ und meine Sinne sind schlagartig in höchste Alarmbereitschaft versetzt.Ich springe aus dem Bett, werfe meinen Pullo-ver und meinen Mantel über, ziehe meine Stiefel an und stopfe die restlichen Kleidungsstücke hastig in den Fußraum des Kinderwagens. Auch Hannes hört die Sirene und weint aus Verwirrung und ob des Unrechts, aufgeweckt worden zu sein. Das lässt auch Käthe hochschrecken, aber es bleibt keine Zeit, um sie zu trösten. Alle anderen im Saal sind in heller Aufruhr darum bemüht, ihre Kinder aus dem Bett zu holen und zumindest teilweise anzuziehen.Die Herbergsmutter empfängt uns mit einer La-terne in der Hand an der Tür, löscht das Licht im
– 45 –Saal und führt uns durch den dunklen Korridor in den Innenhof. Den Kinderwagen muss ich hier zu-rücklassen. Ich setze Käthe auf meine Hüfte und halte Hannes’ Handgelenk umklammert, dann stei-gen wir die Kellertreppe hinab, den anderen krei-debleichen Frauen und ihren weinenden Kindern hinterher.Von irgendwoher wurden behelfsmäßig Bänke herbeigeschafft und als Sitzmöglichkeit für uns entlang der Kellermauern aufgestellt. Die Her-bergsmutter stellt die Laterne in der Mitte auf den Boden, und jede von uns etwa zwanzig Frauen gibt ihr Bestes, um ihre Kinder zu beruhigen. Die zwei kleinen Mädchen, die Hannes „adoptiert“ haben, bringen ihm ihre Puppe, um sie ihm zu zeigen, aber er ist nicht zu trösten und drückt, noch immer schluchzend, sein Gesicht an meine Brust.Als die Sirenen endlich verstummen, hilft das ein wenig, so dass ich Hannes mit seinem Kopf auf meinem Schoß auf die Bank neben mich legen und
– 46 –Käthe in meinem rechten Arm halten kann. Sie ist längst wieder eingeschlafen.Immer wenn jemand spricht, murmeln wir, als ob wir dadurch irgendwie unsere Anwesenheit vor der Gefahr verbergen könnten, die, in welcher Ge-stalt auch immer, da draußen lauert. Wir geben uns große Mühe, etwas zu hören, doch es ist still. Viel-leicht ein falscher Alarm. Ich fühle mich allmählich wieder ein bisschen wohler. Unsere Sorgenfalten auf der Stirn glätten sich.Und dann hören wir es. „Was ist das?“„Psssst!“Mein Körper wird stocksteif.Ein leise dröhnendes Geräusch kommt immer näher. Flugzeuge!Ich drücke die Kinder fester an mich, aber sie wachen nicht auf.Das Geräusch der Flugzeuge wird lauter. Zuerst ein Surren, dann ein Brummen. Wie von aufge-
– 47 –brachten, wütenden Hornissen. Jede Menge Flug-zeuge! Hannes hört sie jetzt auch und beginnt zu weinen, genauso wie einige der anderen Kinder. Die Frauen schauen sich bloß gegenseitig mit weit aufgerissenen Augen an, kummervoll in ihrem Blick, die Gesichter angespannt. Zwar können wir unsere Kinder trösten, doch gibt es nichts, was uns Frauen Trost zu spenden vermag.Einige Minuten lang hören wir nur die Flugzeu-ge, dazu hin und wieder das entfernte Krachen der Flakgeschütze. Vielleicht fliegen sie nur über uns hinweg. Auf ihrem Weg zu irgendeinem militäri-schen Ziel.Ich denke an Johan und frage mich, wo er ist. Ob er diese Flugzeuge heute Abend sieht, in der Ge-wissheit, dass seine kleinen Entlein in Sicherheit sind. Als er im September zu Hause war, schien er voller Zuversicht, dass der Krieg bald eine Wen-dung nehmen würde. Er war derselbe zuversicht-liche Junge, dem ich zum ersten Mal begegnet war,
– 48 –als ihn ein Freund zur Feier meines siebzehnten Geburtstags mitbrachte. Wir hatten uns damals unterhalten, und danach habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mich besonders hübsch für ihn zu ma-chen. „Mein kleines Erikalein“ – so nannte er mich.Ich rieb mit dem Ärmel über meine laufende Nase und über mein nasses Gesicht. Alles ist so verdammt schiefgelaufen.Und dann hören wir eine andere Art von Ge-räusch: das Pfeifen und Knallen von Feuerwerks-körpern. Leuchtraketen?Gleich darauf hören wir etwas Größeres, Tiefe-res und Unheilvolleres als die Flugzeuge, die be-reits über uns hinweggeflogen sind. Es klingt, als ob tausende Züge, gleichzeitig in dieselbe Richtung unterwegs, aus der Ferne auf uns zurattern. Lauter, und immer lauter, das Dröhnen der Motoren kommt näher, und immer näher. Alles ist so durch-dringend laut, dass die Flakgeschütze darunter nicht länger auszumachen sind. Wir spüren den
– 49 –ersten entfernten dumpfen Aufschlag. Wie damals, als ich ein kleines Mädchen war, und die Eiche vor unserem Haus ohne Vorwarnung auf die Straße fiel und das ganze Bett erbeben ließ, aber nur für einen kurzen Moment. Dem ersten dumpfen Aufschlag folgt unverzüglich ein markerschütternder Hagel aus weiteren dumpfen Schlägen, heftigen Knallge-räuschen und dröhnendem Donnern – es fegt auf uns zu. Einige Frauen stoßen spitze Schreie aus. Ich beiße die Zähne zusammen und drücke die Kinder fester an mich. Wir hören Explosionen und Geräu-sche von tonnenschweren Metallmassen, die durch die Luft kreischen; über allem das ständige Dröh-nen der über uns hinwegfliegenden Flugzeug-schwärme. Das Dröhnen wird schließlich schwächer und wir nehmen nur noch ein paar Explosionen sowie die Sirene eines Feuerwehrwagens wahr, der auf der Straße über uns vorbeifährt. Geräusche von Menschen sind nicht zu hören. Es gibt keinen
– 50 – Anhaltspunkt für den angerichteten Schaden. Wir haben die Bombardierung überlebt, doch welche Hölle auf Erden erwartet uns da oben? Der Angriff hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Mein Körper schmerzt von der steifen Anspannung. Die Herbergsmutter sagt, es sei noch keine Entwar-nung gegeben worden, also sollten wir bleiben, wo wir sind.Mich fröstelt, als ich mich mit dem Rücken an den kalten Putz der nackten Steinwand lehne, wo-bei ich zum ersten Mal bemerke, dass ich völlig durchgeschwitzt bin. Ich füttere Käthe und strei-che Hannes über den Kopf, dann döse ich ein, wäh-rend wir auf das Zeichen für die Rückkehr in unse-re Betten warten. Dresden wurde angegriffen. Aber wir haben überlebt. Wir Glückspilze.
– 51 –Kapitel 8Wir sitzen nun schon seit einigen Stunden im Schutzraum. Ein gelegentliches Flüstern ist zu hören, doch die meisten von uns versuchen, sich auszuruhen, oder zumindest die Augen zu schlie-ßen. Es muss weit nach Mitternacht sein. Die Later-ne ist wohl irgendwann ausgemacht worden, denn es ist jetzt völlig dunkel hier unten. Von der Straße über uns haben wir mehr Verkehr wahrgenom-men: Lastwagen und andere Fahrzeuge, die nach Westen in Richtung Stadtmitte fahren.Und dann hören wir ein Motorengeräusch, das nicht von der Straße kommt. Dasselbe leise ent-fernte Brummen, welches wir schon wenige Stun-den zuvor vernommen hatten.Oh, mein Gott! Nein, nicht schon wieder! Eine Frau beginnt, hysterisch zu kreischen, ich halte die Kinder fest an mich gepresst. Dasselbe Brummen wird bald zu einem Donnern, gefolgt vom Pfeifen
– 52 –und dem schrecklichen todverkündenden Heulen der auf uns zustürmenden Bomben. Diesmal er-schallen die dumpfen Schläge spürbar näher, über uns ist das Zerbersten von Glas und das Krachen und Knacken von Holzbalken zu hören. Die Kinder brechen in lautes Weinen aus, und von uns Frauen können nun die meisten ein grelles Schreien oder gellendes Stöhnen nicht mehr zurückhalten. Meine Hände zittern entsetzlich, während ich versuche, die Decke, die wir mit nach unten genommen ha-ben, über unsere Köpfe zu ziehen. Käthe schreit. Auch Hannes brüllt auf meinem Schoß liegend: „Mami! Mami!“„Ich habe auch Angst, Hannes!“ Ich bin nicht länger in der Lage, ihm Trost zu spenden. Ich bin nicht länger stark genug, ihn zu beschützen.Und bald, wie auch zuvor, verhallt das Dröhnen der Motoren. Es wird allmählich ruhiger im Schutz-raum, als die Kinder erschöpft in den Schlaf glei-ten. Wir können einander nicht sehen, aber ich
– 53 –weiß, dass die anderen Frauen ebenfalls völlig am Ende ihrer Kräfte sind, so wie ich. Eine Frau, die sich näher an der Tür befindet, summt sachte die Melodie eines Kirchenlieds. O Gott. Du hast uns wieder behütet. Aber für wie lange?Schließlich haben wir das Gefühl, dass es drau-ßen inzwischen hell werden muss. Das Licht kriecht um den Türrahmen herum und durch einen Riss im Holz unmittelbar unter der Türklinke zu uns herein. Steif und durchgefroren steigen wir die Treppe hinauf, blinzeln im Licht und im herumwir-belnden Staub. Die Fenster des Gebäudes sind zer-borsten, ein paar Glassplitter hängen wie Eiszap-fen in den Rahmen. Alles ist mit schwerem Staub überzogen, ein ekelhaft beißender Rauch liegt in der Luft, doch von hier sieht es so aus, als hätte das Haus noch Dach und Wände.Der Kinderwagen steht bei den anderen, dort, wo ich ihn zuvor abgestellt habe. Ein Mauerbro-cken ist auf ihn gefallen, ich schiebe ihn zur Seite
– 54 –und lege die Kinder in den Wagen. Als wir uns auf den Weg zum Eingangsbereich des Gebäudes ma-chen, hören wir zum ersten Mal Stimmen.Wir treten auf die Straße, unsere Augen bren-nen von der giftigen Luft. Die Häuser um uns her-um stehen noch, die meisten haben alle Fenster verloren, die Vorhänge flattern im Freien, aber sonst wirkt alles recht normal – abgesehen von ei-nem seltsamen Dröhnen, und erst als wir uns um-drehen, um in Richtung Altstadt zu sehen, offen-bart sich uns das Inferno. Die ganze Stadt steht in Flammen, die Rauchwolke verdeckt den Himmel. Oh, mein Gott! Wie konnten sie nur? Wie kann je-mand nur so hasserfüllt sein? Der Wind auf unse-rem Gesicht fühlt sich heiß und klebrig an.Jetzt befinden sich viele Menschen auf der Stra-ße. Es ist dort sicherer als in einem Gebäude, wel-ches jeden Moment explodieren könnte, wenn die Gasleitung dem Druck nicht länger standhalten kann. Lastwagen mit Kriegsgefangenen sind auf
– 55 –dem Weg in die Stadt. Sie wurden einberufen, um bei der Beseitigung der durch ihre Landsleu- te verursachten Schäden zu helfen. Ebenso sind Truppen des BDM und der HJ2 unterwegs, vermut-lich zu den Triage-Notfallstationen, die eingerich-tet wurden, um den Verwundeten Hilfe zu leisten. Der größte Teil der Betriebsamkeit bewegt sich der Innenstadt entgegen: Frauen, die Eimer tragen oder Karren vor sich herschieben, alte Männer mit Schaufeln über den Schultern. Die Stadt braucht sie. Wer weiß, welches Ausmaß an Zerstörung wir vorfinden, aber ich kann einen Eimer tragen, eine Schaufel schwingen, irgendetwas kann ich schon tun. Sie können uns hassen. Sie können die Hölle auf uns herabregnen lassen. Aber unseren Geist brechen sie nicht. Wir mögen hier alle einan-der fremd sein. Doch wir sind immer noch eins. 2 Abkürzung für „Hitlerjugend“
– 56 –Wahrscheinlich sind schon Menschen aus der gan-zen Region unterwegs, um zu Hilfe zu eilen. Durch den Rauch hindurch können wir erkennen, dass die Frauenkirche noch steht – noch sind wir nicht verloren.Während wir dort stehen, gefesselt von dem sich uns bietenden Bild des Grauens einer wunder-schönen Stadt in Flammen, gehen ein paar Leute aus der Altstadt kommend an uns vorbei. Frauen mit ihren Kindern, alle über und über mit grauer Asche bedeckt. Leere, erschrocken blickende Au-gen, die aus Ascheleibern herausstarren. Ein altes Ehepaar wankt an uns vorbei, sie umklammern ei-nander fest an den Armen, sie gehen stocksteif und schmerzerfüllt, ihre Haare und Kleider riechen wie versengt. Dann nähert sich eine Frau, sie schiebt eine Schubkarre, ein Sack oder eine alte Decke überdeckt ihre Fracht. Als sie unmittelbar an uns vorbeigeht, stelle ich mit Entsetzen fest, dass es ein Körper ist, ein Bein ohne Fuß ragt an der Seite her-
– 57 –aus, und ich beuge mich schnell über Hannes, um seine Augen vor diesem Anblick zu schützen. Ich frage mich, ob es vielleicht eines ihrer Familien-mitglieder sein mag, welches sie vor sich her-schiebt, und ob sie noch weitere von ihnen zu tra-gen hat, und ob sie überhaupt noch da sein werden, wenn sie zurückkommt, um sie zu holen – oder ob die Brände sie bis dahin aufgefressen haben.Wir haben uns inzwischen entweder auf den Stufen oder auf dem Randstein niedergelassen, während die Herbergsmutter ins Haus geht, um uns einen Krug mit Wasser und mehrere Becher herauszubringen. Durstig trinken wir, unsere Keh-len sind von der Überanstrengung und dem bei-ßenden Rauch ganz rau.Als wir dort sitzen, kommt ein kleiner Junge, nicht viel älter als Hannes, die Straße herunter. Er ist mutterseelenallein. Eine aus unserer Gruppe ruft ihm etwas zu, aber er scheint es nicht zu hö-ren. Sie geht zu ihm hinüber und führt ihn zu uns.
– 58 –Er hat keine Schuhe an und trägt noch immer den Schlafanzug, in dem er gestern Abend unter die De-cke gesteckt worden war. Er zittert unkontrolliert, und so packen wir ihn warm ein und geben ihm et-was Wasser. Wer weiß, welches Grauen er gerade miterleben musste. Ob er überhaupt alt genug wer-den wird, um sich jemals von dieser furchtbaren Tortur zu erholen?Mittlerweile kommen immer mehr Menschen aus Richtung der brennenden Stadt. Eine Frau mit weißen Haaren geht vorbei, und erst als wir uns ansehen, erkenne ich, dass sie wahrscheinlich in meinem Alter ist. In ihren Armen trägt sie ein totes Baby, vermutlich nur ein paar Wochen alt. Ein zar-ter junger Trieb, dessen Lebensatem von der gifti-gen Luft ausgehaucht wurde. Als unsere Blicke sich treffen, spüre ich, wie sie zu sagen scheint: „War-um solltest du mehr Glück haben?“Während ich die Hände der beiden im Kinder-wagen aufrecht sitzenden Kinder fester drücke
– 59 –und der heiße Wind die Trümmer über uns hin-wegbläst, vernehme ich wieder ein entferntes Brummen. Wir drehen uns alle um und schauen durch den Rauch der Stadt nach Westen. Wir kön-nen nichts sehen, doch hören wir das Brummen. Es wird immer lauter.„Oh, mein Gott! O nein! Nein, nein, nein, nie-mand kann so grausam sein!“Aus dem Rauch brechen die Umrisse von Flug-zeugen hindurch. Es sind so viele, dass sich der ganze Himmel über uns auf der Stelle schwarz färbt. Schreiend packen wir unsere Kinderwagen und Kinder und rennen zum Tor, das in den Innenhof führt. Die erste Bombe fällt auf die hilflose Stadt; der Hagel von dumpfen Schlägen kommt immer näher. Der Lärm von Explosionen, zusammenstür-zenden Gebäuden und schreienden Menschen ist ohrenbetäubend. Und über alledem das monotone Dröhnen der Flugzeugmotoren.
– 60 –Wir haben es in den Innenhof und bis zu den oberen Stufen der Kellertreppe geschafft. Als ich in den Kinderwagen greife, um die schreienden Kin-der herauszuheben, jagt die Druckwelle einer Explo- sion auf der Straße durch die Tür und schleudert mich rückwärts kopfüber gegen eine Mauer. Ich schreie, doch ich kann mich nicht hören. Ich schreie aus Leibeskräften, aber in meinem Kopf ist nur ein Dröhnen. Ich versuche, mich nach vorne zu ziehen und robbe über den Boden in Richtung des Kinder-wagens, der auf die Seite geschleudert wurde.„Hannes! Käthe!“ Ich rufe ihre Namen, doch ich höre meine eigenen Worte nicht.Mit aller Kraft versuche ich, nach dem Kinder-wagen zu greifen, aber mein Körper macht nicht mit. Ich kann Hannes sehen, sein Gesicht ist mir zu-gewandt. Seine schönen weichen braunen Augen schauen mich an, ohne zu blinzeln.„Hannes!“ Ich sehe, wie eine dunkle, dicke Flüs-sigkeit aus seiner Nase und aus seinem Ohr rinnt.
– 61 –Ich sehe Käthes Bein, das schlaff über seiner Brust liegt. Immer wieder versuche ich, sie zu fassen zu kriegen, aber ich komme nicht näher an sie heran. In meinem Kopf höre ich etwas wie das Rauschen eines tosenden Meers. Wieder schreie ich. Dann blendet mich ein weißer Lichtblitz.ENDE
– 62 –SchlussSie wurden sofort ausgelöscht. Erika, Hannes und Käthe wurden zu Asche verbrannt und da-mit Teil der grauen Staubwolke, die sich über die Stadt legte. Ebenso erging es unzähligen anderen, die das Grauen der vergangenen Nacht gemeinsam durchlitten und sich dabei an ihre Hoffnung ge-klammert hatten – vergebens.Sie wurden allenfalls zu schwarzen Zahlen auf weißem Papier, um in einer weiteren Statistik auf-zutauchen, die immer wieder je nach Bedarf für den aktuellen politischen Zweck manipuliert werden kann. Aber Erika und ihre Kleinen sind nicht einmal dort zu finden. Ihr Verschwinden, ebenso wie das zehntausender anderer, wurde nicht einmal bemerkt. Es gibt nur eine Grausamkeit, die schlimmer ist als Hass: jemanden gar nicht erst zu beachten. Fast je- de Familie hat damals jemanden zu Unrecht verloren, und zahllose Familien haben alle Angehörigen ver-
– 63 –loren. Doch nach Meinung der Experten hat diese junge Frau NIE existiert. Der jahrzehntelange Streit um die Zahl der Opfer des Bombenterrors lässt auf die psychologischen Tricksereien schließen, die genutzt werden, um den Wert der Deutschen her-abzusetzen. Man will davon ablenken, welche Aus-wirkungen Kollektivbestrafung auf ein Volk hat.Die skrupellosen Schreckgestalten und Blutsau-ger, die der unbedarften Lebensfreude die Würde aushauchen, haben einer ganzen Nation die Fähig-keit geraubt, normal zu sein. Einer Nation, in der Blumen, die in Liebe auf ein Grab gelegt werden, einfach in den Müll geworfen werden können – mit der gleichen verächtlichen „Wegwerfgeste“, mit der die Nationalflagge weggeschmissen wird, die man ihnen überreicht. Welche Art von Unsicherheit er-fasst diese Anti-Deutschen, die sich so sehr vor Blu- men fürchten? Es gärt damit ein ruheloser Selbst-hass in ihnen, der aus der eigenen Haut herausfah-ren will. Sie wollen ihre eigene Existenz mitsamt
– 64 –ihren Gefühlen auslöschen. Sie wollen sich selbst ausrotten. So geht es also um die Ausrottung eines Volks, das Gott selbst als Volk vorgesehen und ge-schaffen hat. Es ist ein Volk mit einem nutzbrin-genden, schöpferischen Auftrag in dieser Welt. Es ist nicht als Volk gedacht, das in seinen eigenen unterdrückten Gefühlen gefangen ist und in der Angst lebt, dass es jemand atmen hören könnte. Erika, o Erika, wir hören dich. Gott hat gewis-senhaft alle deine Tränen aufgefangen. Wir schä-men uns nicht, für eine Million Erikas zu weinen, zu trauern – oder auch zu schreien. Ihr Leid damals bestand darin, dass niemand, nicht einmal Erika selbst, ihren eigenen Urschrei hören konnte. Doch wir müssen diese unerträgliche ohrenbetäubende Stille, die in unseren Köpfen sowohl wegen vergan-genen als auch gegenwärtigen Ungerechtigkeiten tobt, nicht länger aushalten. Es ist in Ordnung, jetzt zu schreien – um normal zu sein. © 2024 William und Lisa Toel
Auch von William und Lisa Toel:Es ist gut Deutscher zu sein.Bletchley Park: Die psychologische Kriegsführung gegen Deutschland.Kurt ’45: Eine Rheinwiesenlager-Geschichte.Die sieben Ungerechtigkeiten.Neue Weltordnung: Das Gesicht des wahren Feindes.Gefahr! Moralische Höhen!www.williamtoel.de/flipbooksund von Elspeth:Constanzes Kind: Ein Geheimniswww.williamtoel.de/constanzes-kind
ERIKAwww.williamtoel.deMit ihrem Bezug zu der hier behandelten historischen Begeben- heit ermöglicht diese Geschichte dem Leser den bestmöglichen Zugang zu tiefsitzenden und bisher unausgesprochenen Gefühlen – und somit zu seiner eigenen Familiengeschichte, die schon seit so langer Zeit tief in der Seele eines jeden schlummert.Wir müssen diese unerträgliche Stille nicht länger aushalten. Vergangene und gegenwärtige Ungerechtig-keiten werden geheilt.